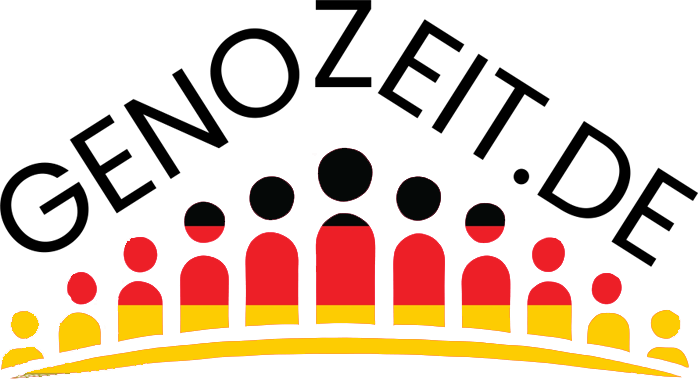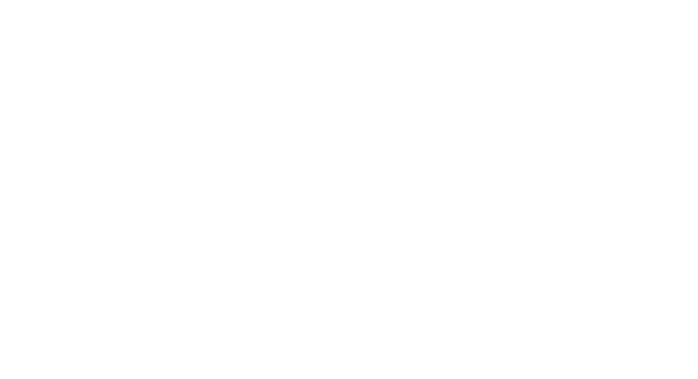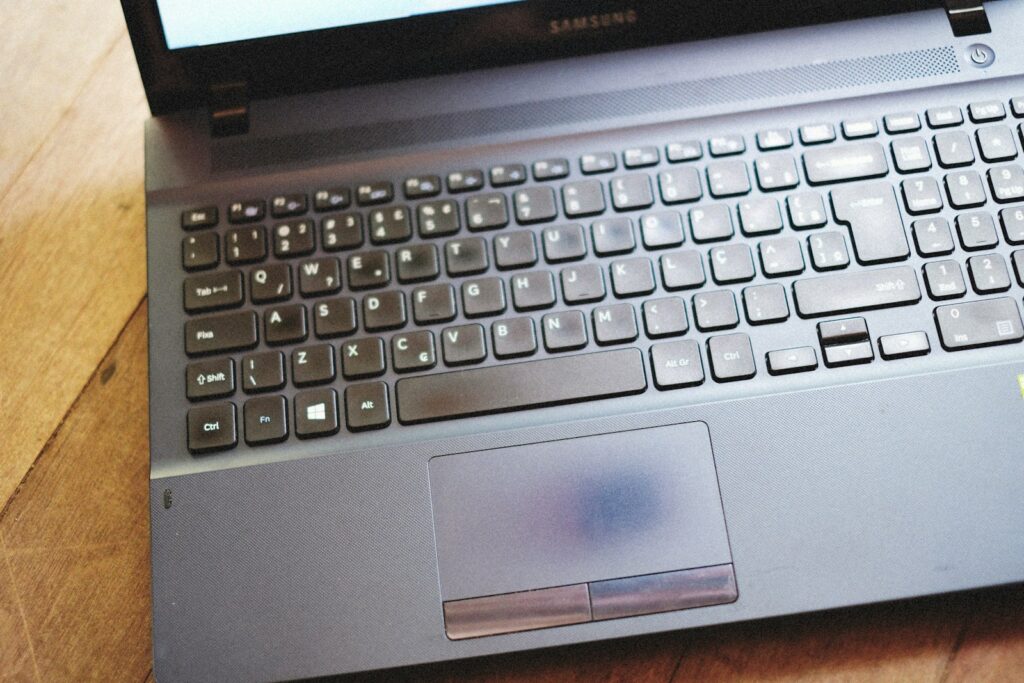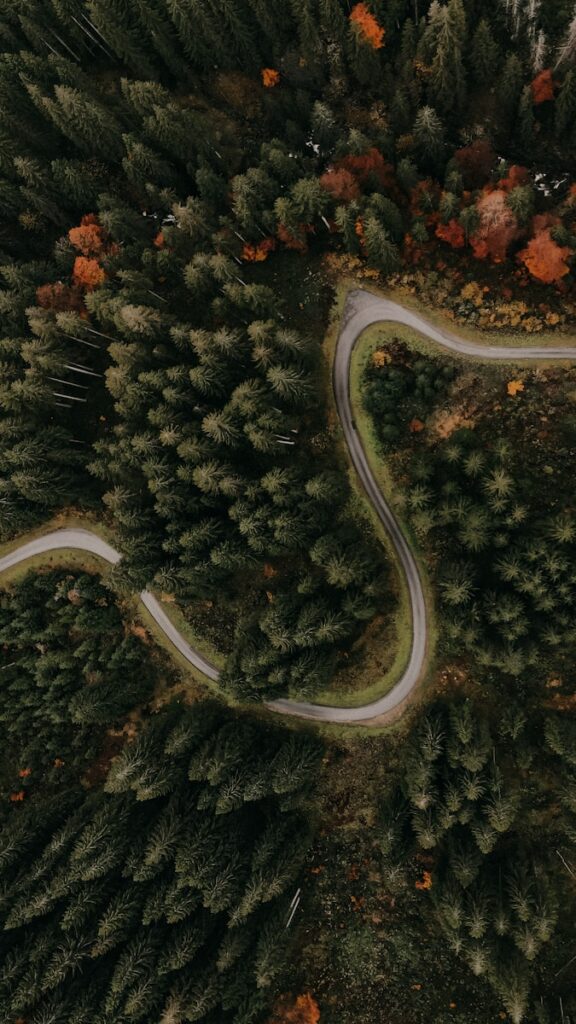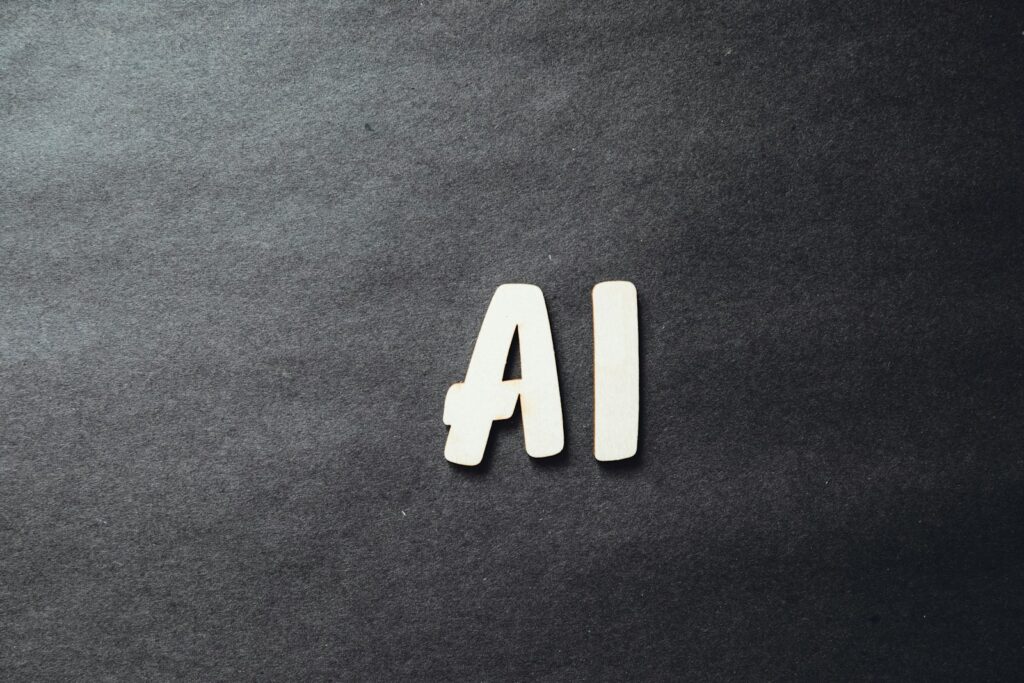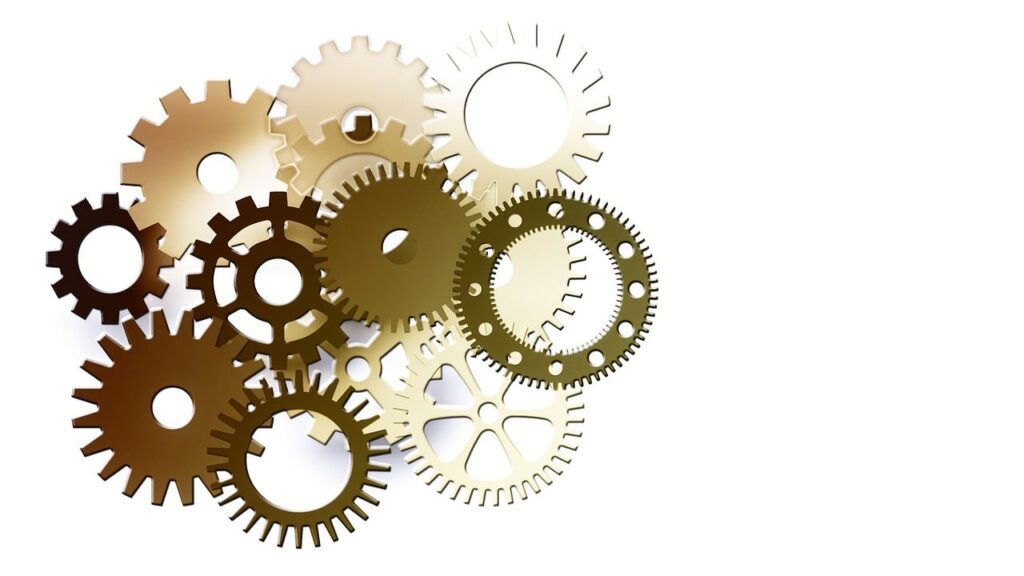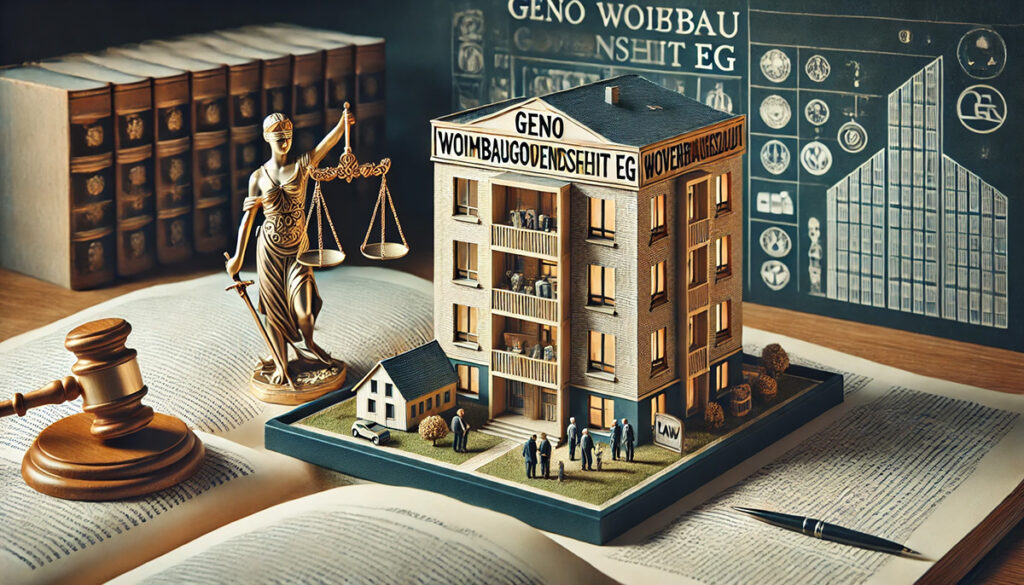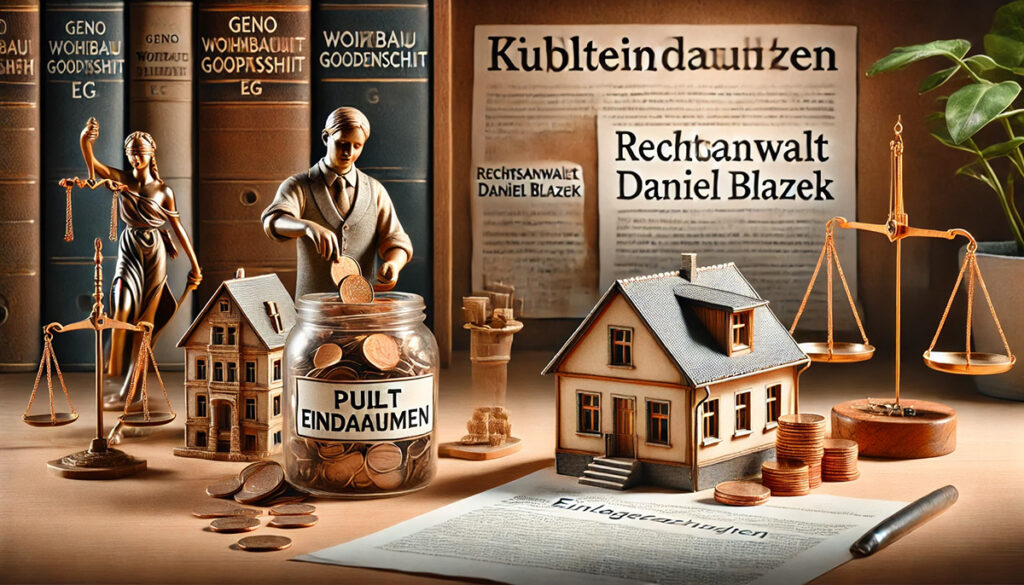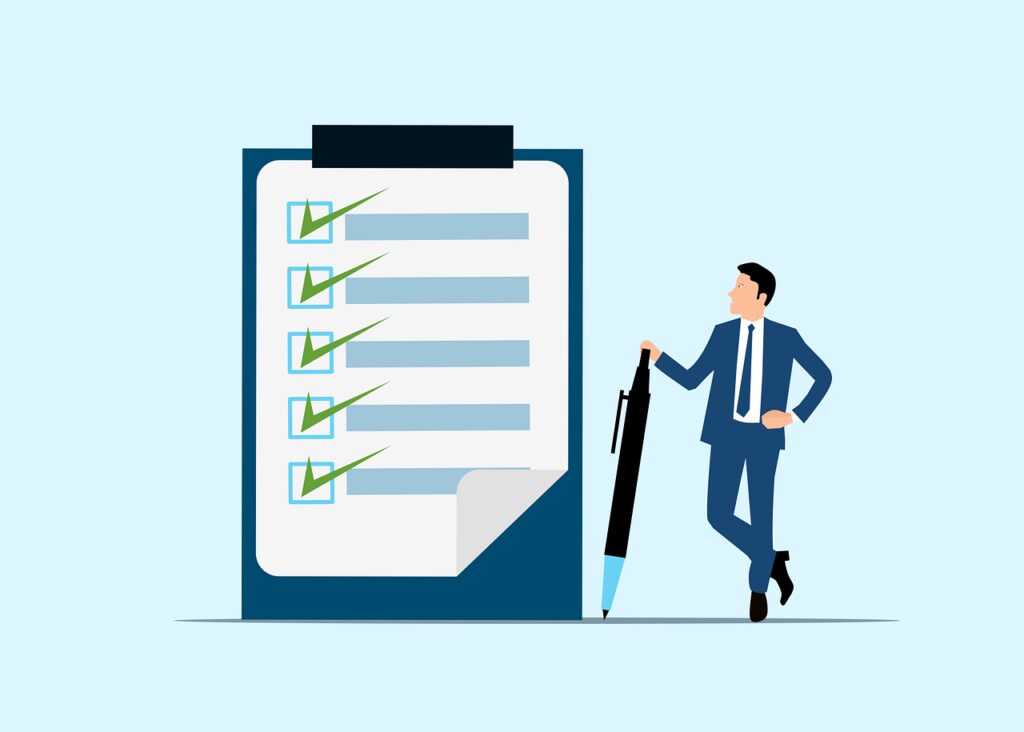„Bezahlbarer Wohnraum braucht klare Regeln“ – Interview mit Rechtsanwalt Reime zur Wiedereinführung der Wohnungsgemeinnützigkeit

Interviewer : Herr Reime, zum 1. Januar 2025 wurde in Deutschland die Wohnungsgemeinnützigkeit wieder eingeführt. Können Sie unseren Leserinnen und Lesern kurz erklären, was darunter zu verstehen ist?
Reime: Gerne. Die Wohnungsgemeinnützigkeit bedeutet, dass Wohnungsunternehmen, die sich dauerhaft dem Ziel verschreiben, bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen, steuerlich gefördert und rechtlich privilegiert werden. Das System gab es bereits bis 1990. Mit der Wiedereinführung versucht der Gesetzgeber, dem akuten Wohnungsmangel und den steigenden Mieten entgegenzuwirken. Es geht also um eine Rückbesinnung auf Gemeinwohlorientierung im Wohnungsbau.
Interviewer: Welche Voraussetzungen müssen Wohnungsbaugenossenschaften oder andere Träger erfüllen, um den Status „gemeinnützig“ zu erhalten?
Reime: Die Voraussetzungen sind relativ streng – und das ist auch gut so. Zum Beispiel müssen die Wohnungen dauerhaft günstig vermietet werden, es dürfen keine Gewinnabsichten im klassischen Sinne verfolgt werden, und Rücklagen müssen im Sinne des sozialen Wohnungsbaus verwendet werden. Zudem müssen Transparenzpflichten eingehalten und Missbrauch ausgeschlossen werden. Eine bloße Etikettierung als „gemeinnützig“ reicht also nicht aus – es geht um nachweisbares, dauerhaftes Engagement für bezahlbaren Wohnraum.
Interviewer: Kritiker befürchten, dass diese neue Regelung Schlupflöcher schaffen könnte – zum Beispiel für Investoren, die sich steuerliche Vorteile sichern wollen, ohne tatsächlich gemeinnützig zu handeln. Wie schätzen Sie das ein?
Reime: Diese Sorge ist nicht unbegründet. Der Gesetzgeber ist zwar bemüht, den Missbrauch durch klare Anforderungen und Kontrollen zu verhindern – aber wie so oft liegt die Herausforderung in der praktischen Umsetzung. Wichtig wird sein, dass die zuständigen Behörden – etwa Finanzämter und Wohnungsaufsichten – engmaschig prüfen, ob die Kriterien eingehalten werden. Sobald hier zu lasch agiert wird, droht die Idee verwässert zu werden.
Interviewer: Und was bringt die Neuregelung aus Sicht der Mieter?
Reime: Im Idealfall Sicherheit und faire Mieten. Mieter profitieren von dauerhaft niedrigen Mieten, planbaren Nebenkosten und einem Vermieter, der sich nicht primär am Profit orientiert. Das schafft Vertrauen – und entlastet vor allem Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Aber auch Studierende, Alleinerziehende oder Rentnerinnen und Rentner könnten davon stark profitieren.
Interviewer: Sehen Sie auch Risiken oder rechtliche Grauzonen?
Reime: Ein Risiko ist sicherlich die Grauzone zwischen Gemeinnützigkeit und wirtschaftlichem Handeln. Was ist noch betriebswirtschaftlich sinnvoll, was schon gewinnorientiert? Außerdem könnte ein Nebeneinander von gemeinnützigem und gewinnorientiertem Wohnungsbau neue rechtliche Fragen aufwerfen – etwa beim Zugang zu Grundstücken oder Fördermitteln. Hier wird es noch Klärungsbedarf geben.
Interviewer: Abschließend gefragt: Ist die Wohnungsgemeinnützigkeit ein großer Wurf oder nur Symbolpolitik?
Reime: Sie ist ein sinnvoller Schritt in die richtige Richtung. Aber sie ist kein Allheilmittel. Um den Wohnungsmarkt wirklich zu entspannen, braucht es eine Kombination aus gemeinnützigem, kommunalem und privaten Wohnungsbau – ergänzt durch wirksame Mieterschutzregelungen. Die Wohnungsgemeinnützigkeit kann dabei ein stabiles Fundament sein – aber nur, wenn sie konsequent angewendet und kontrolliert wird.
Interviewer: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Reime.
Reime: Ich danke Ihnen.