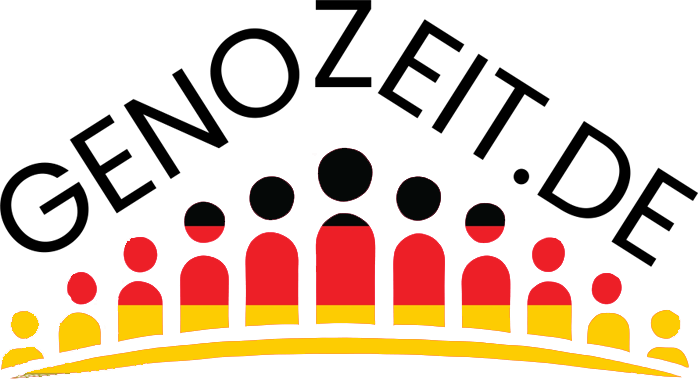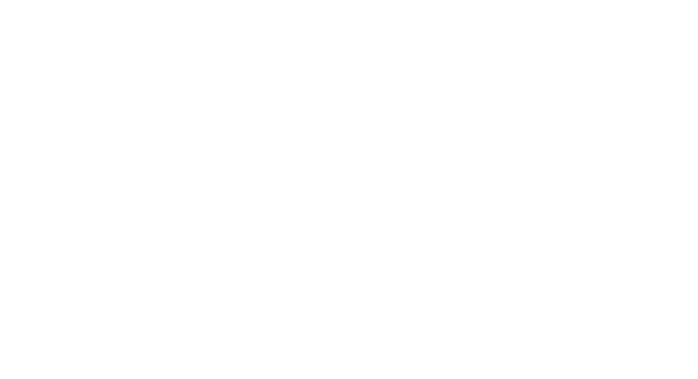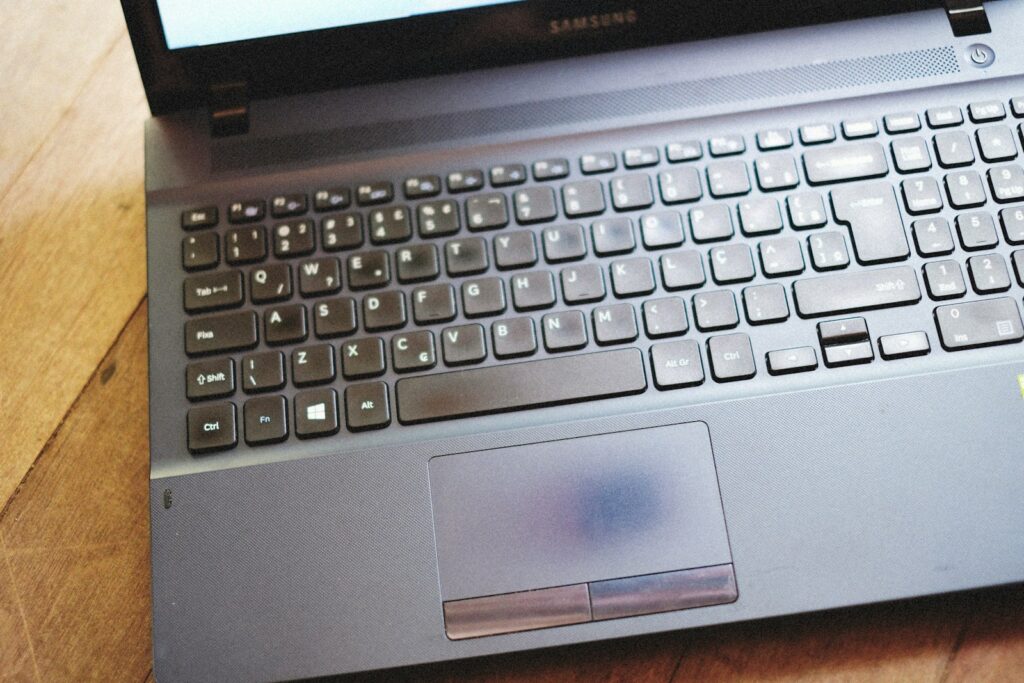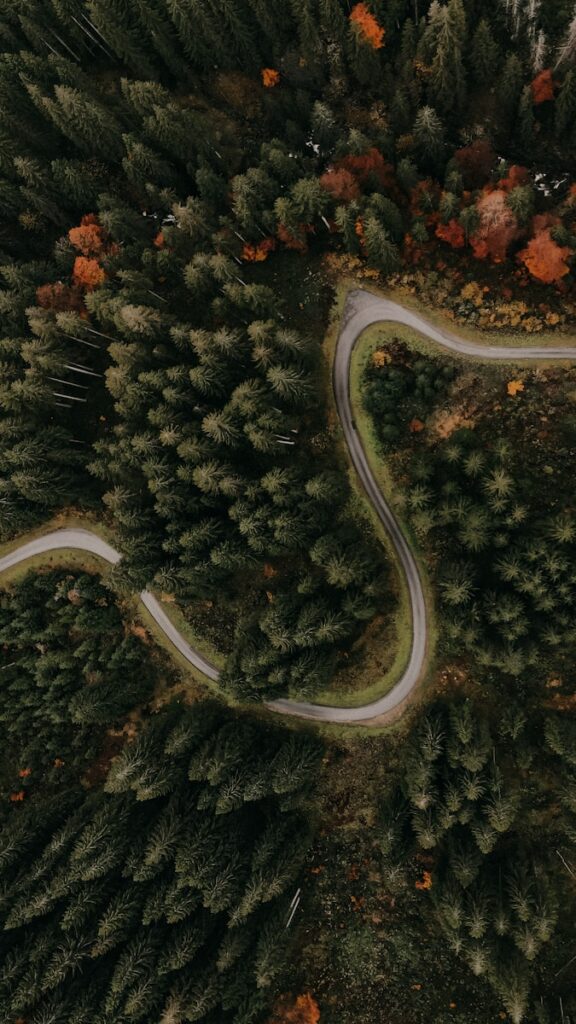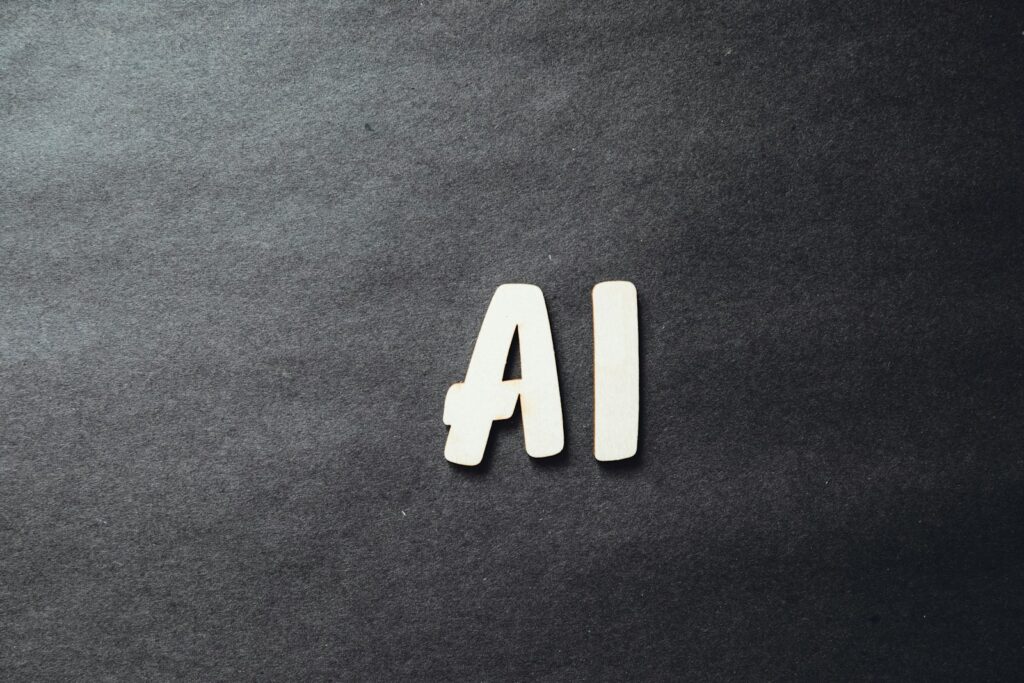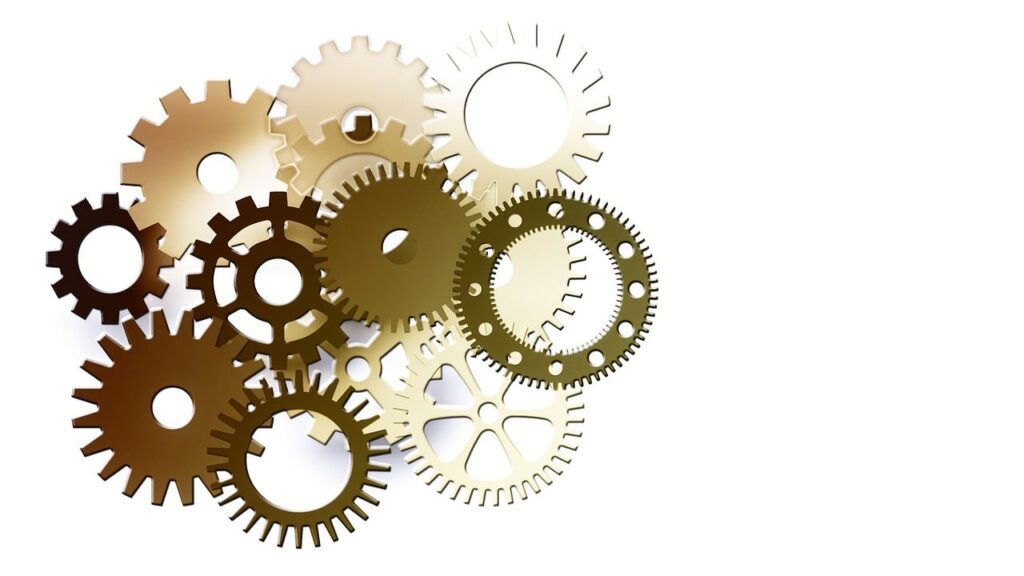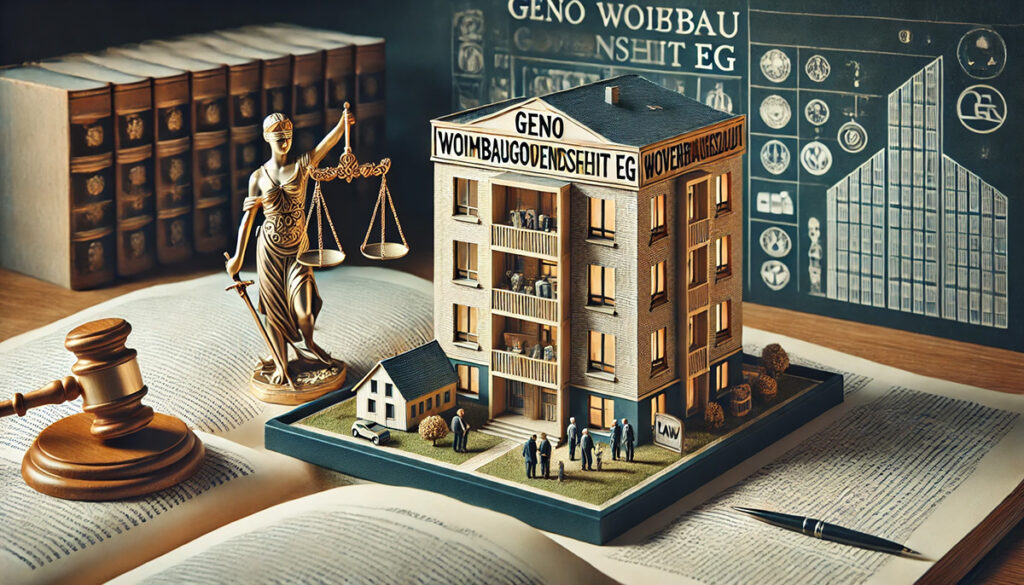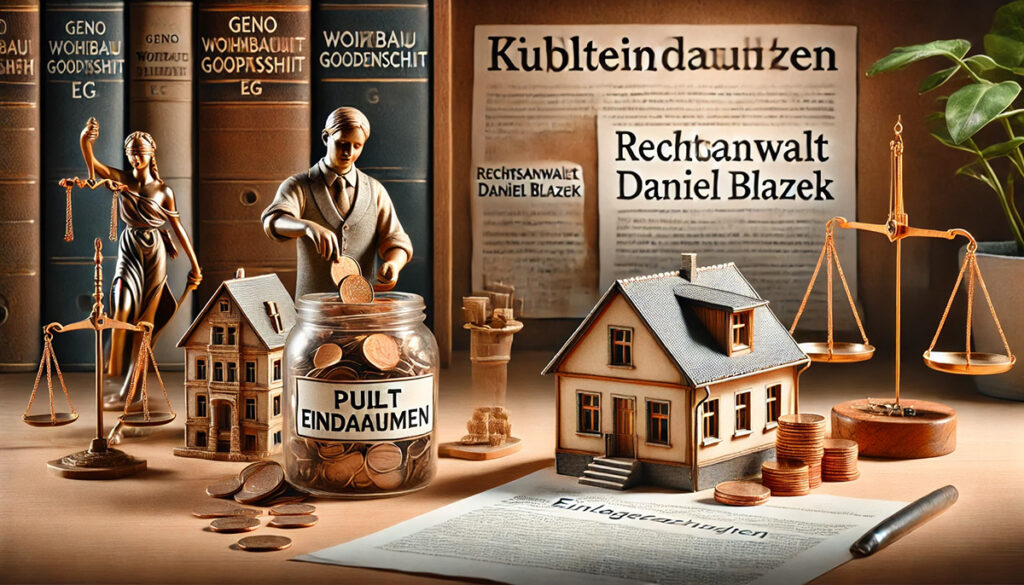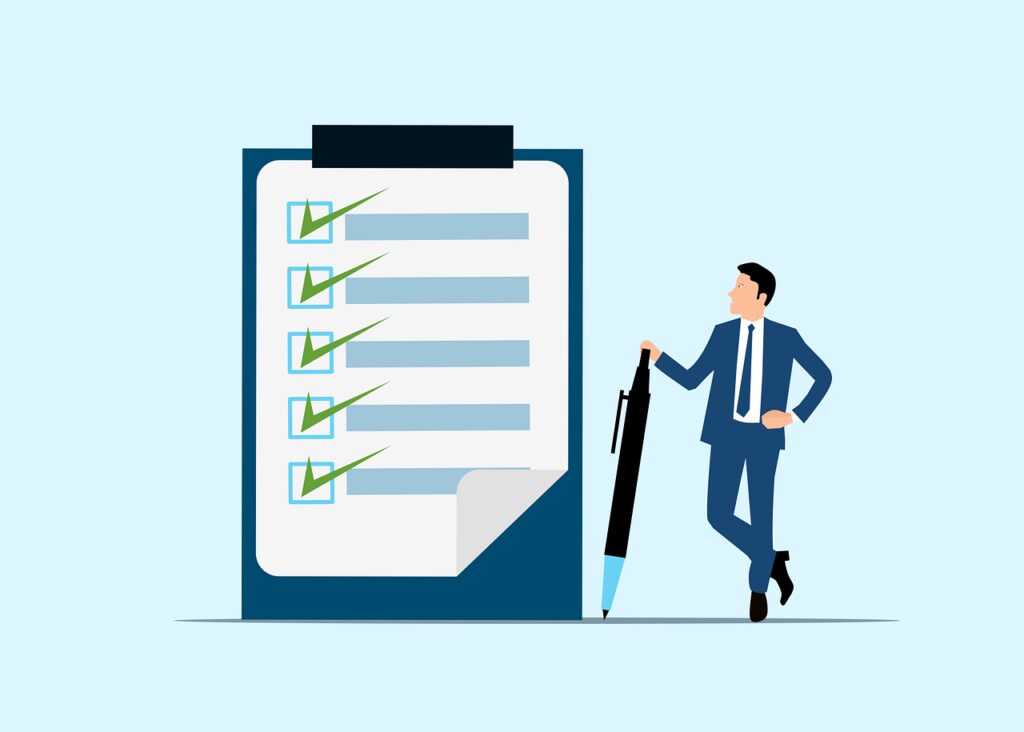„Strom von nebenan – aber noch nicht ganz einfach“: Rechtsanwalt Reime über Bürgerenergiegenossenschaften und Energy Sharing in Deutschland
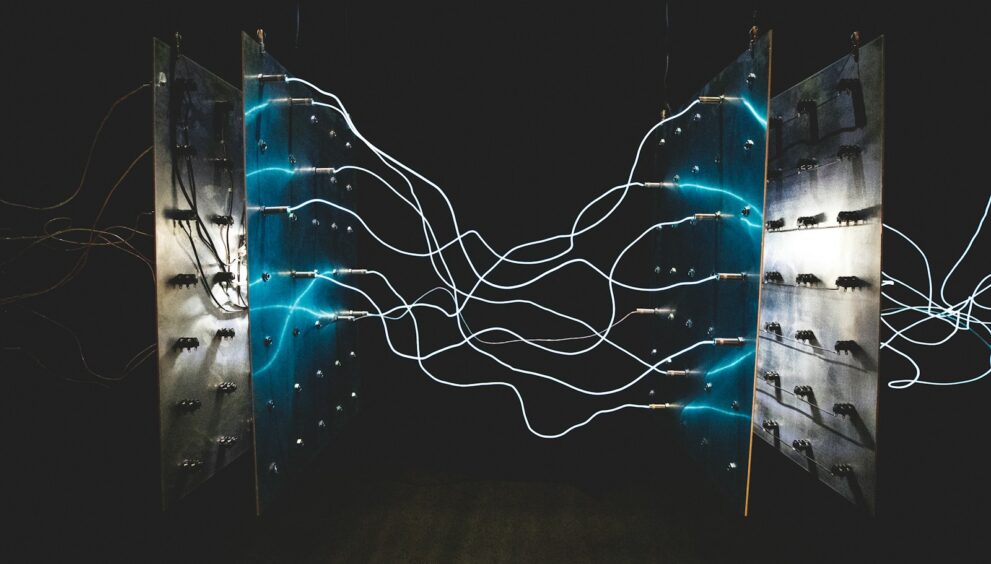
Interviewer: Herr Reime, die Zahl der Bürgerenergiegenossenschaften in Deutschland wächst, insbesondere im Bereich Photovoltaik. Was steckt hinter diesem Trend?
RA Reime: Das Interesse an Bürgerenergiegenossenschaften ist Ausdruck eines grundlegenden Wandels: Immer mehr Menschen wollen nicht nur Energie verbrauchen, sondern auch mitgestalten, woher sie kommt. Das Modell der Genossenschaft bietet dafür die passende Struktur – demokratisch, regional verankert und auf nachhaltige Ziele ausgerichtet. Photovoltaik eignet sich besonders gut, weil sie relativ einfach umzusetzen ist und sich auch in kleineren Projekten rechnet.
Interviewer: Ein Begriff, der aktuell viel diskutiert wird, ist „Energy Sharing“. Was bedeutet das konkret?
RA Reime: Beim Energy Sharing schließen sich Bürgerinnen und Bürger zusammen, um gemeinsam Strom zu erzeugen – etwa durch eine Solaranlage auf dem Schuldach oder ein gemeinsames Windrad – und diesen Strom untereinander zu nutzen. Im Gegensatz zu Einspeiseanlagen, die Strom ins allgemeine Netz verkaufen, geht es beim Energy Sharing darum, den erzeugten Strom möglichst vor Ort zu verbrauchen, etwa in einem Quartier oder einer Kommune.
Interviewer: Und was steht einer solchen Umsetzung in Deutschland derzeit im Weg?
RA Reime: Hauptproblem sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die aktuellen Vorgaben im Energiewirtschaftsrecht und der Stromnetzregulierung behandeln gemeinschaftlich erzeugten Strom wie jede andere Einspeisung ins Netz – mit vollen Netzentgelten, Umlagen und Abgaben. Das macht Energy Sharing in vielen Fällen wirtschaftlich unattraktiv. In anderen EU-Ländern wie Italien oder Frankreich ist man da schon deutlich weiter: Dort gibt es gesetzlich verankerte Erleichterungen für lokale Energiegemeinschaften.
Interviewer: Was wäre nötig, damit das Modell auch in Deutschland besser funktioniert?
RA Reime: Zunächst einmal braucht es eine klare rechtliche Definition von Energy-Sharing-Gemeinschaften, wie sie in der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II) vorgesehen ist. Diese müsste vollständig in deutsches Recht umgesetzt werden. Zweitens müssen die Netzentgelte, Abgaben und Umlagen für lokal erzeugten und genutzten Strom angepasst oder teilweise erlassen werden. Und drittens sollten bürokratische Hürden wie aufwändige Genehmigungs- oder Abrechnungsverfahren vereinfacht werden.
Interviewer: Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass sich das bald ändert?
RA Reime: Die Ampelregierung hat sich im Koalitionsvertrag ausdrücklich zum Energy Sharing bekannt. Auch das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet an einem Gesetzesvorschlag. Allerdings ist der Fortschritt langsamer als erhofft. Die Interessen der etablierten Energieversorger und Netzbetreiber spielen eine Rolle, ebenso wie die Komplexität der technischen Umsetzung. Aber der politische Druck aus der Zivilgesellschaft wächst.
Interviewer: Was bedeutet das alles für Anleger, die in eine Bürgerenergiegenossenschaft einsteigen wollen?
RA Reime: Anleger sollten wissen: Solche Investitionen sind in der Regel nicht auf kurzfristige Rendite ausgelegt. Es geht um stabile, langfristige Erträge, bei gleichzeitigem ökologischen und sozialen Nutzen. Wichtig ist, dass die Genossenschaft transparent wirtschaftet, professionell geführt wird und klare Zielsetzungen verfolgt. Wenn die politischen Rahmenbedingungen sich verbessern, wird Energy Sharing auch finanziell interessanter – und Genossenschaften können zu echten Akteuren der Energiewende werden.
Interviewer: Vielen Dank, Herr Reime.
RA Reime: Sehr gern. Energy Sharing ist ein Schlüssel für eine demokratische, dezentrale Energiewelt – jetzt braucht es den politischen Willen, die rechtlichen Weichen dafür zu stellen.